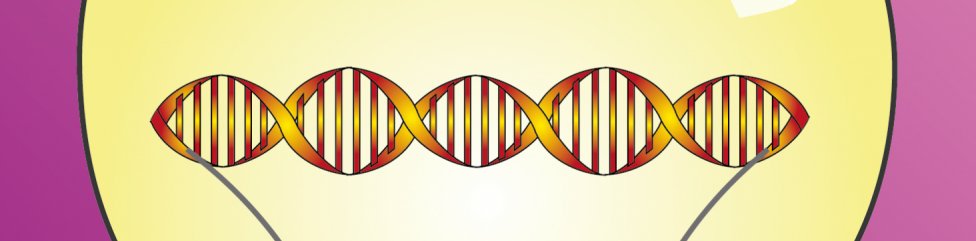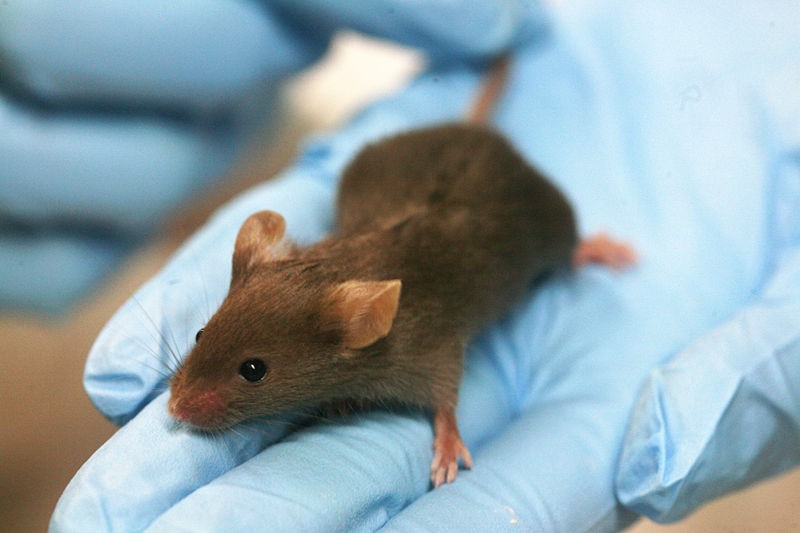 Ich unterschreibe manchmal Petitionen im Internet. Wenn man so eine Petition unterschrieben hat, bekommt man Vorschläge für andere Sachen, die man auch unterschreiben könnte. Und letztens kam da ein Aufruf von PETA, der Tierschutzorganisation. Sie sammelten Unterschriften um AirFrance dazu zu bewegen, keine Affen mehr in Versuchslabore zu fliegen, da diese dort “mit grausamen Experimenten zu Tode gequält” würden. So etwas ärgert mich. Affenquälerei ärgert mich natürlich, aber noch mehr, dass Tierversuche im Rahmen wissenschaftlicher Studien als “grausame Quälerei” bezeichnet werden, weil es irgendwie klingt, als würden wir Wissenschaftler ohne Sinn und Zweck Tiere quälen – nur um des Quälens Willen, weil es uns Spaß macht oder so. Das ist nicht so. Ich will heute ein wenig erklären, wie und warum Tierversuche gemacht werden und was der Sinn dahinter ist.
Ich unterschreibe manchmal Petitionen im Internet. Wenn man so eine Petition unterschrieben hat, bekommt man Vorschläge für andere Sachen, die man auch unterschreiben könnte. Und letztens kam da ein Aufruf von PETA, der Tierschutzorganisation. Sie sammelten Unterschriften um AirFrance dazu zu bewegen, keine Affen mehr in Versuchslabore zu fliegen, da diese dort “mit grausamen Experimenten zu Tode gequält” würden. So etwas ärgert mich. Affenquälerei ärgert mich natürlich, aber noch mehr, dass Tierversuche im Rahmen wissenschaftlicher Studien als “grausame Quälerei” bezeichnet werden, weil es irgendwie klingt, als würden wir Wissenschaftler ohne Sinn und Zweck Tiere quälen – nur um des Quälens Willen, weil es uns Spaß macht oder so. Das ist nicht so. Ich will heute ein wenig erklären, wie und warum Tierversuche gemacht werden und was der Sinn dahinter ist.
Man erinnert sich vielleicht noch an die Skandale um die Testung von Kosmetika an Tieren – Kaninchen, Mäusen oder anderen Sägetieren wurden einzelne Inhaltsstoffe oder fertige Kosmetika verabreicht, in die Augen oder auf zuvor rasierte oder verwundete Hautstellen aufgebracht etc. Solche Tests sind in der EU jedoch seit 2006 verboten. 2013 ging Deutschland sogar noch einen Schritt weiter und verbot auch den Verkauf von an Tieren getesteten Kosmetika. Das ist etwa dann relevant, wenn ein fertiges Produkt aus einem Land eingeführt wird, in dem Tierversuche noch erlaubt sind. Auf diesem Gebiet gibt es in Sachen Tierschutz also große Erfolge zu verzeichnen. Aber warum sind Tierversuche in der Wissenschaft noch immer erlaubt?
Unter dem Begriff “Tierversuch” versteht man das Durchführen wissenschaftlicher Experimente an oder mit lebenden Tieren. “Wissenschaftlich” bedeutet, dass diese Experimente dem Erkenntnisgewinn dienen. Zum einen kann das im Rahmen der sogenannten Grundlagenforschung geschehen, also der Erforschung von Lebensvorgängen im gesunden Organismus. Es wird aber auch erforscht, wie bestimmte Krankheiten entstehen und was dabei im Körper geschieht, oder es werden Medikamente an Tieren getestet.
Doch warum brauchen wir dafür Tiere? Für mich läuft die Antwort auf diese Frage immer auf dieses hinaus: Wollen wir Krankheiten wie Krebs, Alzheimer und Parkinson besser verstehen, behandeln und irgendwann vielleicht sogar heilen können? Wollen wir Menschen helfen? Wenn die Antwort auf diese Frage “Ja” lautet. kommen wir um Tierversuche (noch) nicht herum.
Auch uns Wissenschaftlern macht es keinen Spaß, Tieren Leid zuzufügen. Und ich möchte nicht leugnen, dass Tiere bei solchen Versuchen leiden können. Beispielsweise werden Mäuse genetisch so verändert, dass sie eine bestimmte Krankheit entwickeln. An diesen Mäusen kann man die Krankheit dann erforschen – und oft ist dies die einzige Möglichkeit, Dinge überhaupt zu erforschen.
Allerdings bedeutet “Tierversuch” nicht immer, dass es sich um Wirbeltiere (z.B. Fische und Frösche) oder sogar Säugetiere (wie Mäuse oder Affen) handeln muss. Viele Erkenntnisse kann man auch mithilfe von Tieren gewinnen, die auf der Evolutionsleiter weiter unten stehen, wie z.B. Fliegen und Fadenwürmer. Solche Tiere sind sehr einfach zu halten und vermehren sich schnell, weshalb sie von Wissenschaftlern bevorzugt werden, solange sich mit ihnen auf den Menschen übertragbare Erkenntnisse gewinnen lassen. Und das ist erstaunlich oft der Fall. Ein Beispiel: Das menschliche Gen FMR1 kann, wenn es beschädigt ist, zu Autismus führen (dabei handelt es sich um eine Entwicklungsstörung des Gehirns, die schwere geistige Behinderung nach sich ziehen kann). Im Jahr 2000 entdeckten Wissenschaftler um Gideon Dreyfuss am Howard Hughes Medical Institute in Pennsylvania, USA, dass das Gen FMR1 einen engen Verwandten in der Fruchtfliege Drosophila melanogaster hat. Und erstaunlicherweise entwickelt auch die Fruchtfliege bei Mutation ihres FMR1-Gens Symptome von Autismus; etwa Lern- und Erinnerungsschwächen. Seitdem konnten viele Aspekte der Krankheit mithilfe der Fruchtfliege aufgeklärt werden.
Doch was, wenn man Fliegen und Würmer keine guten Ergebnisse liefern und man doch beginnen muss, an den dem Menschen ähnlicheren Mäusen oder Ratten zu forschen? Der Schritt dahin ist kein leichter und kein Wissenschaftler geht ihn, ohne gründlich darüber nachzudenken. In Deutschland herrschen strenge Regeln, die man bei der wissenschaftlichen Arbeit mit Wirbel- und Säugetieren beachten muss. Jedes Tier braucht genug Platz und Nahrung, seine Umgebung muss saubergehalten werden und es muss unter guten Bedingungen gehalten werden. So müssen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lautstärke in dem Raum, in dem die Tiere leben, ständig überprüft und protokolliert werden. Für Mäuse etwa muss die Temperatur immer zwischen 20 und 24 °C liegen und die Lautstärke darf 60 dB nicht übersteigen – das ist in etwa die Lautstärke einer normalen Unterhaltung. Jedes Institut und jede Universität, die Versuchstiere halten, müssen einen Tierschutzbeauftragten haben, der die Einhaltung der Regeln überwacht. Für jedes einzelne Tier und jedes Experiment muss ein Antrag bei der zuständigen Behörde gestellt werden. All dies ist aufwändig und teuer, darum vermeiden Wissenschaftler Tierversuche mit Säugetieren so weit es geht. Doch manchmal sind sie unumgänglich.
Zur Testung von neuen Medikamenten kommt man um Versuche mit Mäusen und Ratten beispielsweise kaum herum. Doch auch hier ist niemand voreilig. Nur die Medikamente, die sehr wahrscheinlich die gewünschte Wirkung und möglichst wenig Nebenwirkungen haben, werden überhaupt für Tierversuche zugelassen. Zunächst einmal werden Substanzen, die z.B. für die Bekämpfung einer Krankheit eingesetzt werden sollen, an sogenannten Zellkulturen getestet. Zellkulturen sind aus Menschen oder Tieren entnommene Zellen, die im Labor in einem Nährmedium außerhalb des Organismus leben und sich teilen können. Zu einer solchen Zellkultur wird das neue Medikament hinzugegeben und es wird geschaut, wie die Zellen darauf reagieren. Zeigt das Medikament dort die gewünschte biochemische Wirkung und stört es die Lebensfunktion der Zelle nicht, kann der Schritt zum Tierversuch gemacht werden. Denn in einem lebenden Organismus gibt es viele verschiedene Arten von Zellen. Man kann also aus den Experimenten in der Zellkultur nicht genau vorhersagen, wie sich das Medikament im Menschen verhält. Es besteht noch immer die Gefahr, dass es unvorhergesehene Nebenwirkungen hat. Diese Möglichkeit muss mithilfe von Tierversuchen erst ausgeschlossen werden, bevor man den letzten Schritt gehen und das Medikament in klinischen Studien an Menschen verabreichen kann. Überspringt man die Tierversuche, könnten Menschen ernsthaften Schaden erleiden.
Ein weiterer unangenehmer Fakt ist, dass Tiere nach Abschluss einer Testreihe oder eines Forschungsprojekts getötet werden müssen. Warum dürfen sie nicht in die Freiheit entlassen oder als Haustiere gehalten werden? Versuchstiere sind oft genetisch verändert oder aber mit Substanzen, z. B. Medikamenten in Kontakt gekommen, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen (aus demselben Grund darf man alte Arzneimittel nicht in die Toilette schütten). Genetisch veränderte Tiere können sich mit ihren wildlebenden Artgenossen paaren und so veränderte Gene in Umlauf bringen, was die gesamte Population eines Tieres und in der Folge das ganze Ökosystem durcheinanderbringen kann. Das Freilassen von Versuchstieren, von Tierschützern vielleicht gut gemeint, kann also verheerende Umweltschäden verursachen – das kann nicht im Sinne eines Tierschützers sein. Da man nicht kontrollieren kann, was mit Haustieren geschieht und wo sie überall hinkommen, darf man Versuchstiere auch nicht mit nach Hause nehmen. Für die Tötung der Tiere gibt es genaue Vorschriften, die auf geringstmögliches Leid der Tiere abzielen. Sie müssen beispielsweise erst in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt (anästhesiert) werden, bevor sie getötet werden. Der Tod muss augenblicklich, beispielsweise durch Genickbruch, eintreten. Das kann auch nicht jeder Wissenschaftler einfach machen, man muss einen Kurs absolvieren, bevor man überhaupt mit Säugetieren arbeiten darf. Der Umgang mit Tieren in der Wissenschaft ist oft deutlich humaner als der in Schlachtbetrieben.
Doch was hält uns Wissenschaftler davon ab, unsere Tierversuche heimlich durchzuführen, weil wir auf großartige Ergebnisse hoffen und uns den Papierkram sparen wollen? Erstens: Wir sind keine schlechten, skrupellosen Menschen. Zweitens: Weil wir unsere Ergebnisse veröffentlichen wollen. Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften sind die „Währung“ der Wissenschaft – je mehr man hat, desto besser die Karriereaussichten. Und Ergebnisse, die auf illegalem Wege erzeugt wurden, kann man nicht veröffentlichen, da man immer nachvollziehbar angeben muss, wo man die Tiere her hat und ob das Experiment offiziell genehmigt war.
Wissenschaftler quälen Tiere also nicht absichtlich und schon gar nicht zum Spaß. Es macht mich traurig, dass viele ein solches Bild von uns haben. Wir sind Menschen wie alle anderen, mit Gefühlen und Moralvorstellungen. Und wir sind oft die, die eine schwierige Entscheidung treffen müssen: Ist es wichtiger, menschliches Leid zu lindern – oder tierisches Leid zu vermeiden?